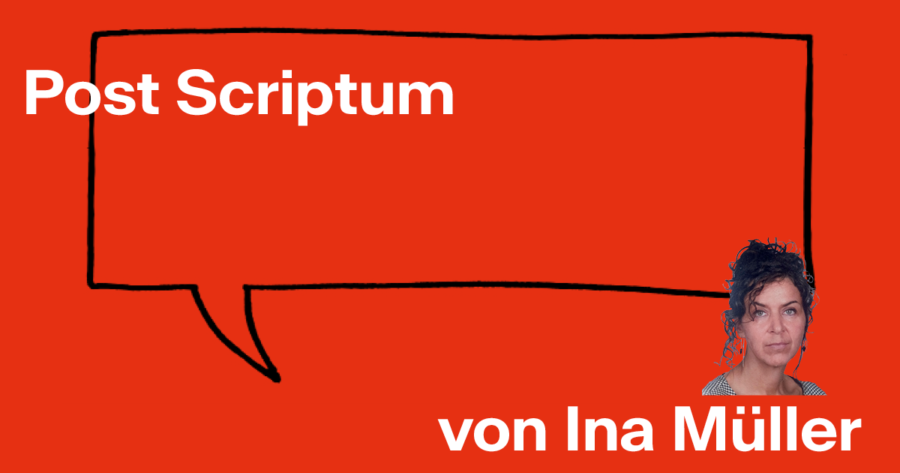Extreme hüben und drüben
Das Palästinensertuch war in meiner Jugend gross in Mode – wir färbten die Keffiah bunt und trugen sie als Halstuch zu allen möglichen Outfits. Erst allmählich wurde mir klar, dass mein Statement für Arafat auf einer weltpolitischen Ebene heftig mit meiner Liebe zu meiner israelischen Tante und ihrem Herkunftsland kollidierte. Denn: Palästinenser zu unterstützen war und ist links. Die Gesinnung meiner Tante, die in der sozialistischen Kibbuz-Struktur aufgewachsen war und in den 1980er-Jahren meinen Hippie-Onkel heiratete, jedoch auch. Bis heute verharre ich bezüglich Nahostkonflikt in dieser unentschiedenen Schwebe: Ich kann weder die eine noch die andere Seite verurteilen. Aber auch nicht freisprechen.
Einerseits hat Palästina als Opfer britischer Kolonialisierung von der UNO den zionistischen Judenstaat aufs Auge gedrückt bekommen, was die arabische Welt nie akzeptiert hat. Andererseits wurden die Juden europaweit verfolgt – und wo sonst hätte man sie ansiedeln sollen, als in jener Gegend, aus der sie ab 700 vor Christus vertrieben worden waren? Zum einen hat sich die jüngere dort ansässige Religion mit ihrem «Islamischen Staat» terroristisch radikalisiert; zum andern hat Israel von seiner Geburtsstunde an ständig weitere Gebiete annektiert (nach eigener Diktion: zurückerobert). Heute betreiben die Islamisten brachiale Retraditionalisierung; Israel fährt einen aggressiven rechtskonservativen Konfrontationskurs.
Dazu passt das schweizerische Wahlergebnis mit seinem markanten Rechtsrutsch. Die obsiegende SVP wird nicht nur von Deutschland her als «rechtsextrem» bezeichnet (tagesschau.de). Ihr Chefstratege hatte auch im Anschluss an den zweiten Weltkrieg beim Ausbau seiner EMS-Werke keine Berührungsängste mit Chemie-Know-how aus dem Holocaust, etwa in der Personifizierung des Obernazis Johann Giesen, den er bis 1970 im Verwaltungsrat behielt. O-Ton: Ein Unternehmer müsse «mit Leuten verschiedener Herkunft arbeiten können» (srf.ch). Das bezieht sich aber nur auf die ‹richtigen Ausländer›. Gegenüber jüdischen Flüchtlingen hat sich die bürgerliche Schweiz bekanntlich nicht mit Ruhm bekleckert. Linke Kritiker ihres willfährigen Zudienens ans Naziregime wurden noch bis zum Erscheinen des Bergier-Berichts in den 1990er-Jahren als Nestbeschmutzer verunglimpft. Die Bürger- und Bauern-Schweiz hat somit dazu beigetragen, dass der jüdischen Gemeinde in der Diaspora der zionistische Judenstaat als einziger Ausweg in ein menschenwürdiges Dasein erschien.
Das ist jedoch nur die halbe Wahrheit. Es gab auch Juden, die nach überlebter Shoah nicht auswandern wollten, oder jedenfalls nicht nach Israel: In eine Wüste, die sie zuerst urbar machen mussten. (Die USA hatten bereits mit dem Immigration Act von 1924 dafür gesorgt, dass Masseneinwanderungen ausblieben [wikipedia].) Stellen wir uns also einmal vor, die überlebenden Juden hätten darauf bestanden, hier ihren früheren Lebensstandard wieder zu erlangen, ihre Wohnstätten, das gestohlene Hab und Gut; hätten auf Entschädigung für erlittenes Unrecht gepocht und darauf, endlich als vollwertige Landsleute in unserer Mitte anerkannt zu werden. Ich fürchte, die rechtschaffen konservativen Bevölkerungen Europas wären dazu nicht bereit gewesen – genau so wenig, wie sie ihre Mitschuld am Genozid anerkennen wollten («man wusste ja nichts»).
Dass die scheinheiligen Schweizer Schäfchen jederzeit ihre xenophoben Wolfszähne ausfahren können, ist leider nichts Neues. Uns damit obendrein politische Stabilisierung zu versprechen, zumal in Nahost, ist nur noch … zynisch? … dummdreist? … bauernschlau?