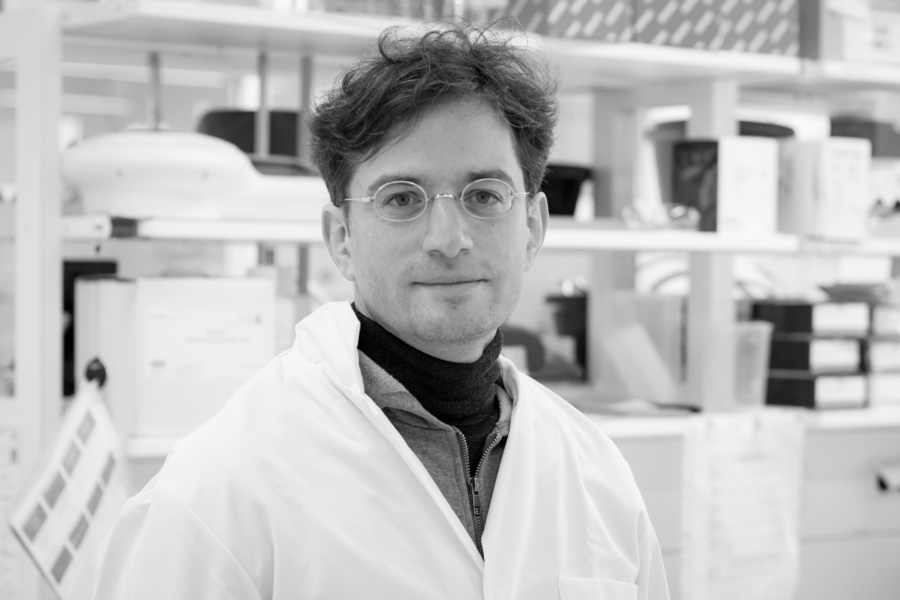Wie weiter, Herr Doktor?
Simon Muster spricht mit Emanuel Wyler vom Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin in Berlin über das vermeintliche Ende der Pandemie, über gelungene und misslungene Kommunikation – und warum sich die Naturwissenschaften wieder mehr politisieren müssen.
Am 6. März 2020, zu Beginn der Pandemie und einen Tag, nachdem die erste Person in der Schweiz am neuen Coronavirus verstorben war, sprach Molekularbiologe Emanuel Wyler mit P.S.-Redaktorin Nicole Soland im Kafi Freud. Jetzt, zwei Jahre später, treffen wir ihn wieder – an selber Stelle, aber unter völlig anderen Voraussetzungen.
Herr Wyler, beim ersten Gespräch am 6. März 2020 im P.S. verzeichnete die Schweiz 100 neue Coronafälle, zehn Tage später rief der Bundesrat den Lockdown aus. Heute sind es ein bisschen mehr als 21 000 Fälle. Und doch: Wir sitzen hier in einem Restaurant, die Angestellten müssen keine Maske mehr tragen. Was hat sich verändert?
Emanuel Wyler: Der entscheidende Unterschied im Vergleich zum März 2020 ist, dass heute ein Grossteil der Bevölkerung immunisiert ist. Viele Menschen sind entweder geimpft oder genesen. Nur unter diesen Voraussetzungen konnte der Bundesrat die meisten Massnahmen jetzt aufheben.
Vor zwei Jahren sagten Sie, unser Immunsystem sei gegenüber dem Coronavirus «naiv».
Genau, und jetzt ist unser Immunsystem dank der Impfung oder den durchgemachten Infektionen besser vorbereitet. Die Bedeutung der Impfung kann nicht genug betont werden: Nach der eher milden ersten Coronawelle traf das Coronavirus im Herbst 2020 auf eine grösstenteils ungeschützte Bevölkerung. Die zweite Welle erfasste zuerst die mobilen unter 40-J ährigen, die dann die älteren und verletzlicheren Menschen ansteckten. Das führte zu sehr vielen Todesfällen im Winter 2020: In Deutschland starben rund zwei Drittel aller Coronatoten zwischen Oktober 2020 und Februar 2021. Dank der Impfung konnten im Frühjahr 2021, als die deutlich ansteckendere und gefährlichere Alphavariante die Infektionen zu einer dritten Welle auftürmte, die Menschen über 80 Jahren geschützt werden. Im zweiten Coronawinter 2021 verzeichneten wir dann nochmals deutlich weniger Todesfälle, weil dann alle, die wollten, bereits geimpft waren.
Bereits im März 2020 äusserten Sie die Vermutung, dass das Coronavirus ein «Wintervirus» sein könnte. Was bedeutet das konkret – ein Wintervirus?
Viren verbreiten sich entlang sozialer Praktiken, das bedeutet: Je nachdem, wie sich Menschen verhalten, können sich Viren besser oder schlechter verbreiten.
Ein Beispiel für dieses Phänomen ist die HIV-Pandemie. Dieses Virus verbreitet sich durch ungeschützten Geschlechtsverkehr. Erst durch eine Aufklärungskampagne in den 1980er- und 1990er-Jahren konnte das Virus eingedämmt werden. Für die Ausbreitung des Coronavirus ist vor allem entscheidend, dass wir uns gerade im Winter oft und zahlreich in engen Räumen treffen. Wir arbeiten in Grossraumbüros, trinken mit Freunden in Bars, veranstalten Familienfeste, fahren in Trams und Zügen zur Arbeit. Zudem ist unser Immunsystem im Winter sowieso schwächer und unsere Schleimhäute – die erste Abwehrbarriere gegen Viren – sind wegen der trockenen Luft ausgedünnt. All das führt dazu, dass sich das Coronavirus SARS-CoV-2 bei uns im Winter einfacher und schneller verbreitet.
Die letzten beiden Punkte treffen aber auf viele Atemwegserkrankungen zu. Warum hat die Wissenschaft und Politik nicht frühzeitig kommuniziert, dass es sich um ein Wintervirus handelt und die Massnahmen darauf abgestimmt?
Die ersten Monate der Pandemie waren geprägt von einer vorsichtigen Kommunikation. Für alle war der Virus neu und unbekannt. Es hätte niemandem etwas gebracht, wenn der Bundesrat Behauptungen aufgestellt hätte, die er später wieder zurückziehen hätte müssen. Diese vorsichtige Kommunikation der Behörden und die grosse Solidarität der Bevölkerung war neben der Saisonalität des Virus der Hauptgrund dafür, dass die erste Welle nicht so stark ausfiel.
Wobei: Gerade in der Anfangsphase der Pandemie schien es bei der Kommunikation zwischen Wissenschaft und Politik oft zu hapern. Teilen Sie diesen Eindruck?
Ja. Ich habe das erst kürzlich mit einer befreundeten Politikerin aus Zürich besprochen. Ein grosser Teil der Bevölkerung, insbesondere Menschen unter 50, haben in ihrem Leben noch nie eine so einschneidende gesellschaftliche Krise erlebt wie diese Pandemie. Sie sind mit dem Anspruch an die Politik getreten, dass sie alle Probleme lösen könne – was diese nur allzu gerne aufgenommen hat. Plötzlich ging vergessen, dass PolitikerInnen – egal wie grosse Worte sie auch verwenden – nicht alles beeinflussen können.
Dazwischen eingequetscht fand sich die Wissenschaft wieder, die zwar täglich mehr über das Virus erfuhr, aber auch mit vielen Unsicherheiten und Ambivalenzen konfrontiert war und ist. Mit dieser Mischung aus bräsigen PolitikerInnen, die sehr selbstbewusst Entscheidungen kommuniziert haben, als wären wissenschaftliche Erkenntnisse immer nur schwarz oder weiss, und einer verunsicherten Bevölkerung, die sich nach Klarheit gesehnt hat, ist die Wissenschaft über die ganze Pandemie hinweg nie wirklich klargekommen.
Haben Sie eine Erklärung, wieso das so ist?
Die Naturwissenschaften sind in den letzten Jahrzehnten unpolitisch geworden. Viele Naturwissenschaftler verstehen heute nicht mehr, dass es neben den Fakten und Zahlen auch Interpretationen, Diskussionen und Ideologien gibt, die auf eine öffentliche Debatte einwirken. Das kommt auch nicht von ungefähr, natürlich möchten sich WissenschaftlerInnen, die einen ständigen Kampf um Drittmittel führen, politisch nicht zu fest exponieren.
Aber gerade in Krisensituationen wie in einer Pandemie oder der Klimakrise soll die Kommunikation von wissenschaftlicher Erkenntnis auch zu Verhaltensänderungen in der Bevölkerung führen. Das ist ein eminent politischer Akt.
Einige WissenschaftlerInnen, wie zum Beispiel Marcel Salathé, haben aber auch sehr offensiv kommuniziert. Ihnen wurde dann aber der Vorwurf gemacht, sie seien aktivistisch.
Stimmt und das ist ja auch gut. Dass man als Wissenschaftler Kritik erhält, wenn man sich öffentlich meldet und Forderungen an die Politik stellt, gehört dazu. Das haben aus meiner Sicht aber auch einige Mitglieder der Schweizer Science Task Force bis am Schluss nicht verstanden. Im Vergleich zu PolitikerInnen wird man als Wissenschaftler mit Samthandschuhen von den Medien angefasst. Schon bevor ich als Wissenschaftler geforscht habe, war ich politisch aktiv. Deswegen bin ich mich auch gewohnt, dass ich für meine Positionen kritisiert werde.
Was sind also die Lehren daraus für die Wissenschaft?
Zwei Dinge: Erstens brauchen die Naturwissenschaften eine Repolitisierung. Sie müssen sich stärker mit ihrer eigenen Rolle in der öffentlichen Debatte auseinandersetzen.
Und zweitens brauchen wir in der Wissenschaftskommunikation eine Art institutionalisierte Unsicherheit. Sogenannte GegenexpertInnen weisen immer auf Ambivalenzen in der Forschung hin, um das Vertrauen in die Wissenschaft zu untergraben. Das hat man während der Pandemie zur Genüge beobachten können.
Deswegen muss die Kommunikation von wissenschaftlicher Erkenntnis transparent den aktuellen Forschungsstand beinhalten und gleichzeitig betonen, dass sich die Wissenschaft nie hundertprozentig sicher sein kann. Das schafft Vertrauen.
Für die Laienbevölkerung ist es aber oft schwierig, herauszufinden, wer die tatsächlichen ExpertInnen und wer sogenannte GegenexpertInnen sind. Wird das Phänomen mit mehr Unsicherheit in der Kommunikation nicht verstärkt?
Es klingt ein wenig nach einer Phrase, aber man muss zwar Unsicherheiten in wissenschaftlichen Erkenntnissen kommunizieren, nicht unsicher, sondern selbstbewusst. Natürlich sind Ambivalenzen nicht so attraktiv für Schlagzeilen oder Twitter. Dafür sind sie ehrlicher.
Gleichzeitig müssen wir als Gesellschaft davon wegkommen zu glauben, dass wir alles mit Technologie kontrollieren können. Der grosse Erfolg der Leitwissenschaften des 20. Jahrhunderts – Physik und Ingenieurwesen – hat zu einer Art Machbarkeitswahn geführt. Aber als Biologe, der sich mit Viren auseinandersetzt, sehe ich jeden Tag, wie viel wir noch nicht wissen.
Wie geht es jetzt weiter, was müssen wir die nächsten Monate erwarten?
Wir sind auf dem Weg in eine endemische Lage, also zu der Situation, wenn eine Krankheit regelmässig auftritt. Ein grosser Teil der Bevölkerung ist jetzt immunisiert. Das schützt zwar nicht vor Ansteckungen. Das Virus wird weiter zirkulieren, aber es wird weniger schwere Krankheitsverläufe und weniger Todesfälle geben. Im kommenden Herbst wird es aber im ungeimpften Teil der Bevölkerung wieder vermehrt zu Hospitalisierungen und Todesfällen kommen. Wir sollten deshalb die Hoffnung nicht aufgeben und die Zeit dafür nutzen, diesen Teil der Bevölkerung von einer Impfung zu überzeugen.
Wir haben also jetzt ein halbes Jahr, um uns auf die nächste Welle vorzubereiten?
Genau. Da der Bundesrat die Teststrategie nun ändert, nimmt die Wichtigkeit des Abwassermonitorings zu. Mit der systematischen Untersuchung von Abwasser können frühzeitig Ausbrüche von Infektionskrankheiten erkannt werden. In Israel gab es 2013 einen Polioausbruch, der nur dank ausgebauten Abwasseruntersuchungen frühzeitig entdeckt wurde. Mit dem systematischen Abwassermonitoring hat Israel 24 Jahre zuvor begonnen. Das Beispiel zeigt uns auch, dass eine effiziente Prävention Investitionen und Geduld braucht. Deswegen sollten wir auch einen Teil der Testinfrastruktur aufrechterhalten. Das kennen wir von den Zivilschutzkellern, die wir für Notlagen mit Millionen von Franken unterhalten. So müssen wir in Zukunft auch über Infektionskrankheiten denken und uns entsprechend vorbereiten. Zum Beispiel sollten wir schon jetzt verschiedene Szenarien für nächsten Winter definieren, mit Grenzwerten, ab welchen bspw. wieder eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr eingeführt wird.
Transparenz: Emanuel Wyler ist Teil eines Analyseteams der Berliner MDC, das in Zusammenarbeit mit den Berliner Wasserbetrieben das Abwasser auf Viren untersucht.
Spenden
Dieser Artikel, die Honorare und Löhne unserer MitarbeiterInnen, unsere IT-Infrastruktur, Recherchen und andere Investitionen kosten viel Geld. Unterstützen Sie die Arbeit des P.S mit einem Abo oder einer Spende – bequem via Twint oder Kreditkarte. Jetzt spenden!