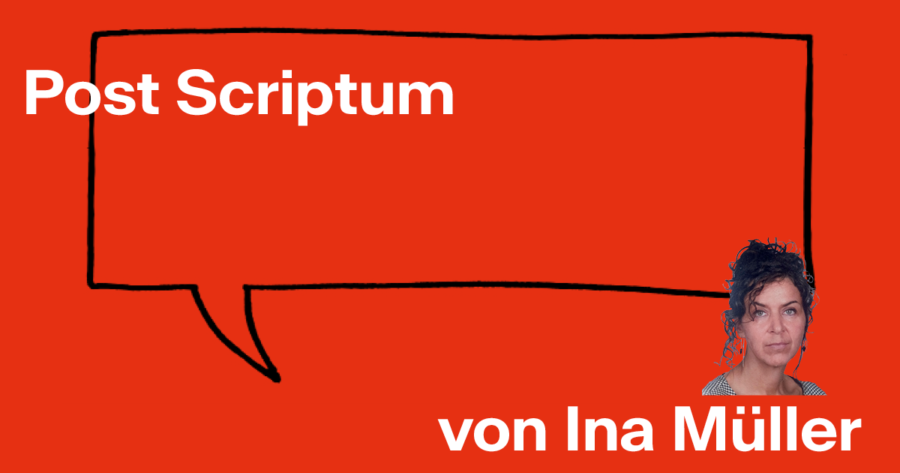Ergebnis: offen …
Das Phantom einer freieren, forschend künstlerischen und experimentellen Pädagogik geistert durch die einschlägige Literatur. Es rät uns – angelehnt an kindliche und künstlerische Weltzugriffe –, Schule schwerpunktmässig als kreatives Spiel und bewegtes Erkunden zu gestalten, experimentelles Forschen und intrinsisch motiviertes Lernen zu fördern und ergebnissoffene Projekte zu selbstgewählten Themen zu ermöglichen. Auf Stillsitzen, Nachahmen, Pauken sei zu verzichten. Denn nur wenn wir unsere Schützlinge
ihre kindlich-fluide, neugierig-flexible Anpackigkeit bewahrten, seien sie für die ungewisse Zukunft im rasanten gesellschaftlichen Wandel unserer Zeit gewappnet.
Das müsste mir als Künstlerin doch gefallen. Stattdessen bin ich misstrauisch. Mir fallen grad lauter Lebensbereiche ein, in denen Ergebnisoffenes nichts zu suchen hat … Beim Aussortieren von Giftpilzen aus den Körbchen der Waldfreunde habe ich keinen kreativen Ermessensspielraum. In der Luftfahrt muss der Vogel oben bleiben, und nicht der Weg, sondern die Flugdestination ist das Ziel. Selten mundet in der Gastronomie experimentell Zähes, Pampiges und Versalzenes. Und in der Musik wie im Tanz gilt: Nur pedantisches Üben bringt Lorbeeren, genialer Einfall hin oder her.
Gerade als Lehrerin im Gestaltungsbereich bezweifle ich, dass in jedem Kind eine Künstlerin oder ein Forscher steckt. So wie auch in den wenigsten ein Spitzensportler oder eine Diplomatin schlummert. Gewiss, wir verfügen alle über Ressourcen und Strategien im Umgang mit Freud und Leid, und die sind manchmal auch kreativ. Forschend-kritisch, sammelnd-reihend, assoziativ-variierend, schillernd-schwebend, bewegt-unbestimmt jedoch selten. Das soll nicht heissen, dass Kunst nur aus Genialität, Drill oder Schmerz entstehen kann. Oder dass gar Stumpfsinn, Zwang und Strafe zum Lernen gehören.
Aber Kunst taugt nicht zum normativen Erfolgsrezept, sie lässt sich nicht instrumentalisieren, um überzogene Anforderungen zu meistern. Der Sehnsuchtsort Kindheit geht einmal unwiderruflich verloren, nicht nur im eigenen Leben, sondern gegenwärtig auch als gesellschaftlich definierter Lebensabschnitt unbehelligter Selbstwerdung. Zu kostbar ist unter neoliberalem Erfolgsdruck diese prägsame Zeit, um sie mit Tändeleien zu vertun. Früh-dies, Früh-das treibt sie beizeiten aus. Ähnlich ergeht es dem Sehnsuchtsort Kunst und ihrem scheinbar unerschöpflichen Quell inspirierter Noch-nie-Dagewesenheiten. Deren befreiende Narretei löst sich spätestens dann in Luft auf, wenn wir unsere inneren Künstler als Humankapital zur Verwertung im Spätkapitalismus ausbeuten sollen.
Die künstlerischen Freiheiten, die Wahlmöglichkeiten und die Jobfitness der Jugend sind hierzulande grösser als je zuvor. Und doch bringen sich hier so viele Junge wie nie und nirgends um, und x-mal mehr bevölkern die Psychiatrien. Sie kriegen keinen Boden mehr unter die Füsse, kommen nirgends mehr an. Im neoliberalen Hype des stetigen Wandels gibt es kein Erbarmen, kein Verweilen. Nichts darf so altehrwürdig sein, dass es sich nicht verscherbeln liesse. Es braucht lauter abgenabelte Individuen, die frei durch immer neue marktinhärente Krisen navigieren, mit nichts als dem Allzweckwerkzeug der projektorientiert-künstlerischen Herangehensweise im Rucksack, um jede noch so harte Nuss zu knacken, die die herrschende Verwertungslogik ihnen an den Kopf wirft …