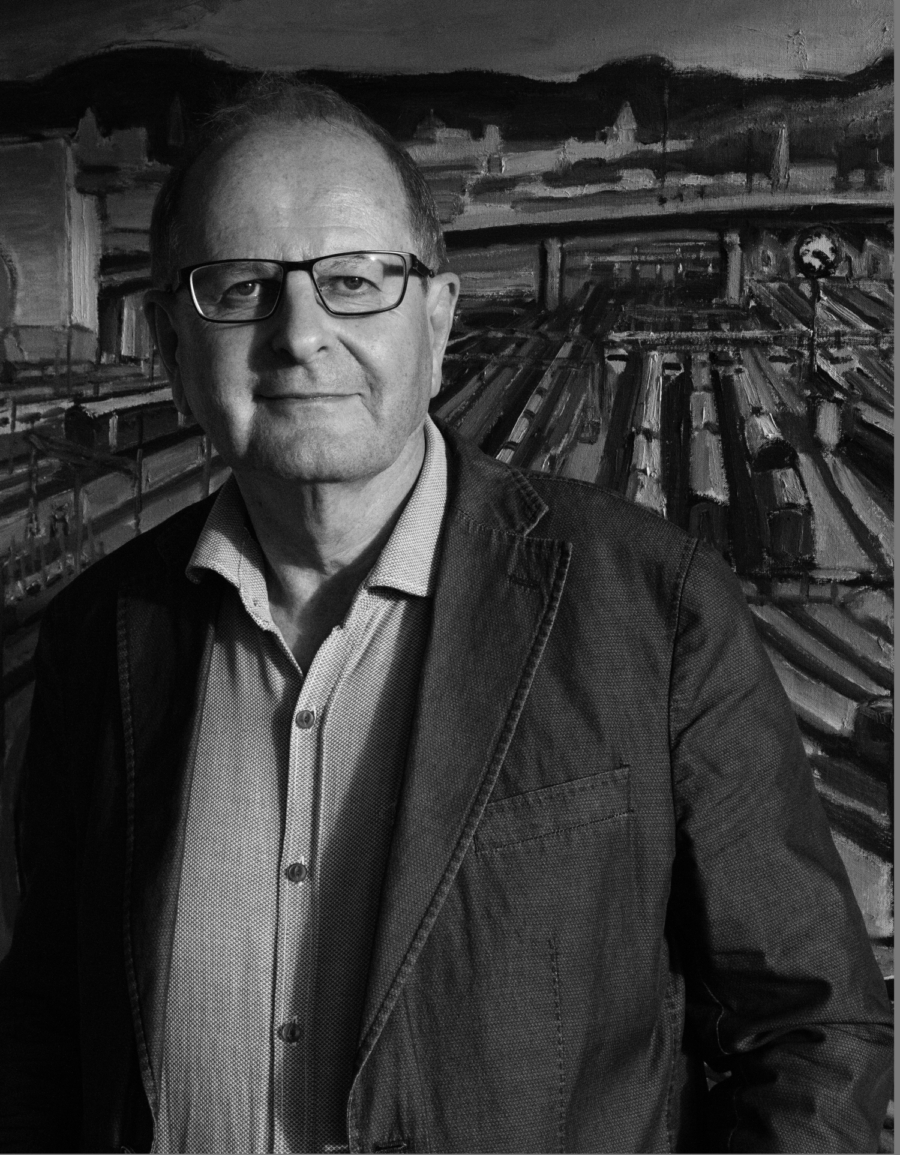Die Zahlen im Griff, die Menschen im Fokus
Wenn Ernst Reimann am 31. Juli den letzten Arbeitstag im Amt für Zusatzleistungen der Stadt Zürich hat, blickt er auf genau 30 Jahre zurück – am 1. August 1990 wurde er stellvertretender Direktor, am 1. Februar 1995 Direktor des Amts. Wie seine Arbeit damals aussah und was in Zukunft ansteht, erklärt er im Gespräch mit Nicole Soland.
Beginnen wir mit der Aktualität: In der gerade zuende gegangenen Sommersession hat das eidgenössische Parlament Überbrückungsleistungen für Menschen beschlossen, die mit 60 Jahren oder später ausgesteuert werden. War das eine gute Idee?
Ernst Reimann: Ja, diese Überbrückungsleistungen sind eine gute Sache. Wer jahrzehntelang gearbeitet hat und kurz vor der Pensionierung die Stelle verliert, muss heute zur Sozialhilfe. Damit fährt er oder sie schlecht, sind deren Leistungen doch auf einem deutlich tieferen Niveau angesiedelt als die Arbeitslosenunterstützung. Bevor er oder sie überhaupt etwas bekommen, müssen sie ihr Vermögen obendrein soweit aufbrauchen, dass weniger als 4 000 Franken übrig sind. Das ist, auf Deutsch gesagt, ein «Tritt is Füdli» dieser Menschen. Mit der neuen Überbrückungsrente fahren sie besser. Die Leistungsverbesserung hat bekanntlich auch eine politische Komponente; sie soll mithelfen, die Begrenzungsinitiative der SVP zu bodigen, die im September an die Urne kommt. Das gibt der Sache einen unangenehmen Beigeschmack – es wäre besser gewesen, wenn die Politik von allein darauf gekommen wäre, etwas für diese Menschen zu tun. Immerhin: Wer auf das Geld angewiesen ist und dank der neuen Regelung mehr bekommt, dem oder der dürfte das egal sein.
Der ursprüngliche Vorschlag des Bundesrats war grosszügiger, aber offensichtlich nicht mehrheitsfähig…
Was der Bundesrat wollte, wäre tatsächlich klar besser gewesen, und eine Mehrheit im Nationalrat hätte den Vorschlag sogar angenommen. Doch der Ständerat stellte sich leider quer; federführend bei diesem Manöver war der Zürcher FDPler Ruedi Noser.
Wenn Sie von der Aktualität zurückblicken zu den Anfängen: Wie hat sich das System der Zusatzleistungen in den letzten 30 Jahren gewandelt?
Im Grundsatz und in der Systematik ist es gleich geblieben: Es gibt Ergänzungsleistungen (EL) nach Bundesrecht, Beihilfen und Zuschüsse nach kantonalem Recht und schliesslich Gemeindezuschüsse nach städtischem Recht. Weiterentwickelt hat sich das Leistungsniveau, das nach und nach der Teuerung und der Lohnentwicklung angepasst wurde. Der Mischindex, der zur Berechnung von AHV und IV dient, wird auch bei den Ergänzungsleistungen angewendet. Das bedeutet, dass letztere keine riesigen Sprünge machten. Zudem werden die grössten Ausgabeposten, nämlich die Miete und die Gesundheitskosten, in der Regel effektiv berücksichtigt. Menschen mit Zusatzleistungen (ZL) bekommen beispielsweise auch Beiträge an die Franchisen oder für Zahnbehandlungen, also für jene Leistungen, die man sonst selber berappen muss.
Und dieses Geld reicht, um in der teuren Stadt Zürich alles Nötige bezahlen zu können, hohe Mieten inklusive?
Bei den Mieten hat der Bund in der Vergangenheit tatsächlich versagt: Er definierte für die ganze Schweiz einheitliche Standards dafür, welche Beträge für die Miete bei den EL maximal angerechnet werden dürfen, nämlich 1100 Franken pro Monat für Alleinstehende und 1250 Franken für Ehepaare. Damit in der teuren Stadt Zürich die ZL-RentnerInnen über ein angemessenes soziales Existenzminimum verfügen und höhere Mietzahlungen möglich sind, bezahlt die Stadt rund 45 Millionen Franken pro Jahr. Die kommunalen Leistungen sind im Zürcher Gemeinderat stets praktisch ohne Gegenstimmen angenommen worden, sprich, von der AL bis zur SVP stehen alle dahinter. Darüber bin ich froh, denn es erleichtert jenen Menschen, die Mühe damit haben, auf ZL angewiesen zu sein, den Schritt hin zur Anmeldung.
Ab dem 1. Januar 2021 steht eine Systemänderung beim Bund an, wie die Stadt Zürich am 27. Mai mitteilte: Was genau ändert sich?
Ab dann gibt es bei den EL gemäss Bundesrecht drei regional unterschiedliche Maximalwerte, was bedeutet, dass in der Stadt Zürich neu maximal 1370 Franken Mietkosten pro Monat angerechnet werden dürfen. Damit kann sie den Gemeindezuschuss im Bereich der Mietzinsen, mit dem die Differenz ausgeglichen wird, anpassen: Der EL-Beitrag ist neu so hoch wie früher der EL-Beitrag inklusive Gemeindezuschuss. Oder anders gesagt: Nach der bisherigen Verordnung waren rund 87 Prozent der realen Mietzinse mit den ZL abgedeckt, neu werden es rund 92 Prozent sein – es werden also mehr AHV- und IV-RentnerInnen in der Lage sein, ihre Mietkosten zu decken. Entsprechend hat der Stadtrat zuhanden des Gemeinderats eine Vorlage verabschiedet, die vorsieht, die Gemeindezuschüsse so anzupassen, dass statt wie bisher maximal 1375 Franken Miete neu 1500 Franken zulässig sind.
Gab – oder gibt es in näherer Zukunft – weitere Verbesserungen?
Eine positive Entwicklung gab es für jene Menschen, die in Alters- und Pflegeheimen leben: Bis 1997 waren sie relativ schlecht gestellt. Viele konnten die Heimkosten auch dann nicht vollumfänglich zahlen, wenn sie das Maximum an Zusatzleistungen erhielten, und mussten für den Rest Sozialhilfe beziehen. Seit 1997 richtet die Stadt Zürich Pflegekostenzuschüsse aus, und damit konnte dieser Missstand behoben werden. 2008 war es sodann möglich, die Pflegekostenzuschüsse faktisch wieder abzuschaffen, weil unterdessen der Neue Finanzausgleich eingeführt worden war und deutliche Verbesserungen brachte: Seither sind die EL für Menschen, die in Heimen leben, grundsätzlich unbegrenzt, die Steuerung erfolgt über die Heimtarife.
Geht das gut? Die Steuereinnahmen sind bekanntlich begrenzt…
Die Ausgaben werden gesteuert, indem die Stadt Einfluss auf die Heimtarife nimmt. Das bedeutet, dass jemand, der auf Leistungen angewiesen ist, einen guten Platz in einem Heim bekommt – aber keinen Luxus à la Seniorenresidenz. Dahinter steckt das altbewährte Prinzip, dass, um es mit einem Vergleich zu illustrieren, jeder die Möglichkeit haben soll, mit dem Zug nach Bern zu fahren, aber nicht in der ersten Klasse. Oder nehmen wir die Zahnarztkosten: Implantate beispielsweise werden nicht übernommen, da es sich nur 20 bis 25 Prozent der Menschen hierzulande leisten können, selber Implantate zu berappen. Die Mietkosten in den Heimen schliesslich lassen sich heute besser steuern als früher, weil das Angebot grösser ist: Als die Wartelisten für einen Platz im Alters- oder Pflegeheim noch ellenlang waren, liess sich diesbezüglich logischerweise weniger ausrichten.
Stimmt es eigentlich, dass immer mehr Menschen auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind?
Die Sozialleistungsquote liegt, sehr langfristig betrachtet, stets irgendwo zwischen 4,6 und 5,3 Prozent; in den letzten Jahren waren es weniger als 5 Prozent. Stark gestiegen ist die finanzielle Belastung: Einerseits wurden Mieten und Gesundheitskosten stetig teurer, andererseits ist die Zahl der RentnerInnen gestiegen, unter anderem, weil die Menschen heute älter werden als noch vor 30 oder 50 Jahren. Die Aussage, es gebe «immer mehr» BezügerInnen von EL, stimmt so nicht: Der Anteil der AHV-RentnerInnen insgesamt, die auf EL angewiesen sind, hat sich in den letzten 20, 30 Jahren nicht gross verändert. Von den BewohnerInnen von Alterseinrichtungen sind heute rund 60 Prozent auf EL angewiesen, früher waren es etwas weniger. Das rührt daher, dass sich die Politik Ende der 1990er-/Anfang der Nuller Jahre von der Objektfinanzierung zu verabschieden begonnen hat, sprich, nicht mehr den Alters- und Pflegeheimen direkt Geld gab. Dadurch hoben diese ihre Tarife an, und viele BewohnerInnen konnten nicht mehr alles selber zahlen. Das fing man mit der sogenannten Subjektfinanzierung auf – man bezahlte fortan den Menschen, die nicht die ganze Rechnung stemmen konnten, Ergänzungsleistungen.
In Zahlen?
1990 brauchte die Stadt Zürich 162 Millionen Franken pro Jahr für Zusatzleistungen, heute sind es rund 600 Millionen. Allerdings muss man bedenken, dass von diesen 600 Millionen rund 145 Millionen Franken Pflegebeiträge sind. Das geht auf die Neuordnung der Pflegefinanzierung von 2011 zurück: Im neuen Krankenversicherungsgesetz (KVG) der damaligen Bundesrätin Ruth Dreifuss, das 1995 in Kraft trat, war vorgesehen, dass der Bund via KVG die Pflegekosten übernehmen würde. Bald stellte sich aber heraus, dass das nicht funktionierte. Neu leisteten die Krankenkassen stetig höhere Beiträge, wo rauf die Prämien stiegen und stiegen, trotz zusätzlicher Prämienfinanzierung und weiterer Zuschüsse. Das Ganze mündete schliesslich in ein dreiteiliges Modell: Einen Teil übernimmt die Person, die im Heim lebt, selber (bei ZL-RentnerInnen wird dieser Eigenanteil in die Berechnung genommen), einen Teil stemmen die Krankenkassen, und den letzten Teil machen öffentliche Pflegebeiträge aus. Letztere belaufen sich in der Stadt Zürich auf rund 145 Millionen Franken pro Jahr.
Damit übernimmt die Stadt nicht mehr bloss die Kosten, die sonst nicht gedeckt wären, sondern einen fix eingerechneten Betrag?
Ja, die urspüngliche «Restfinanzierung» ist zur «Hauptfinanzierung» geworden. Das ist sozialpolitisch gesehen allerdings kein Problem, finde ich, denn es handelt sich ja um eine Finanzierung via Steuergelder, und Steuern werden bekanntlich entsprechend der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erhoben. Eine solche Finanzierung ist sozialer als die Kopfprämien der Krankenkassen. Die Steuerung der Kosten ist den Krankenkassen aber besser möglich, daher sollten sie auch wieder vermehrter an Bord.
Dennoch: Wer eine (zu) schlecht bezahlte Stelle hatte, muss im Alter Steuergelder in Anspruch nehmen: Diese Umverteilung von Lasten von den Unternehmen hin zum Staat ist nicht sehr sozial.
Dazu muss man differenzieren: Unsere sogenannten Wohnungsfälle haben ein Einkommensproblem. Die HeimrentnerInnen hingegen haben ein Auslagenproblem: Wenn 60 Prozent der HeimbewohnerInnen auf EL angewiesen sind, dann ist das kein Ausdruck von zu geringen Einkommen. Zudem erhalten zwei Drittel der HeimbewohnerInnen erst dann EL, wenn sie ins Heim eintreten; vorher hat die Rente gereicht. Das heisst, bei den Wohnungsfällen stimmt die These von der Umverteilung teilweise; hier finden sich Menschen aus Tieflohnbranchen, aber auch Menschen, die Teilzeit oder lange im Ausland gearbeitet haben und entsprechend tiefere Renten erhalten. Von den RentnerInnen, die einst tiefe Löhne hatten, waren übrigens früher 82 Prozent Frauen, heute sind es noch 68 Prozent. Ob das ein Fortschritt ist, bleibe dahingestellt… Fest steht, dass das ZL-System sehr träge reagiert, weil die jahrzehntelange Arbeitsbiographie bestimmt, ob jemand ZL benötigt und falls ja, wie hoch Leistungen sein müssen zur sozialen Existenzsicherung. Ich kann deshalb nichts dazu sagen, wie Corona sich darauf auswirkt. Aber wir sehen heute die Folgen der Ölkrise 1971 und der darauf folgenden Rezession 1973/74 – damals verloren viele Menschen ihre Jobs oder konnten nur noch Teilzeit arbeiten, weshalb sie heute als RentnerInnen weniger Geld zur Verfügung haben.
Kommen wir zum Schluss: Würden Sie heute nochmals Direktor des Amts für Zusatzleistungen werden wollen?
Wenn man eine neue Stelle antritt, bestimmt der Zufall mit, was einen dort wirklich erwartet, doch ich habe damals eine gute Entscheidung getroffen: Die Arbeit war und ist stets interessant. Auch das Arbeiten an der Schnittstelle von Verwaltung und Politik hat mir gut gefallen; ich habe immer gern politisiert, auch wenn ich nur vier Jahre, von 1986 bis 1990, für die SP im Gemeinderat war. Gut, manchmal ärgerte ich mich auch über die GenossInnen: Ich sehe zum Beispiel nicht ein, weshalb meine Partei (nicht in Zürich, national in Bern) bisweilen so tut, als gäbe es keine EL, und zum Beispiel eine 13. AHV fordert. Klar ist das mit der Begründung, die Altersarmut mildern zu wollen, durchaus legitim. Nur bedenken meine GenossInnen dabei nicht, dass bei einem solchen Systemwechsel jene, die es am nötigsten haben, weniger EL und damit insgesamt weniger Geld bekämen. Gleichzeitig rufen andere in der SP nach EL für Familien, was ich sehr begrüssen würde. Oder eben neu Überbrückungsleistungen nach dem EL-System; aber was man zur Beseitigung der Alters- und Behindertenarmut geschaffen hat, damit bekundet man Mühe – schade.
Und was machen Sie ab dem 1. August?
Ich habe vor zwei Jahren Ideen für die Zeit nach der Pensionierung auf ein A4-Blatt geschrieben. Es war schnell voll, worauf ich es weggeworfen habe: Ich mache mir keine Sorgen, dass es mir langweilig werden könnte.